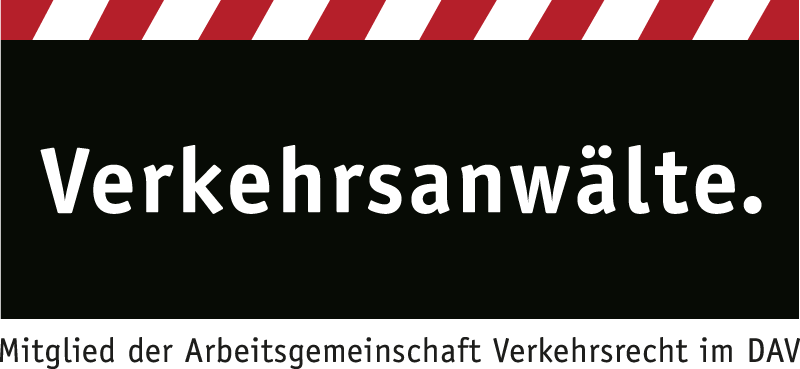Keine Fernabschaltung einer Autobatterie

Manchmal kann man doch froh sein, dass es die Verbraucherschutzvereine gibt. Ein solcher Verein hat vom BGH die Frage prüfen lassen, ob die Klausel in AGB für einen Mietvertrag über eine Autobatterie, wonach eine Fernabschaltung der Batterie möglich ist. Die Klausel war so gestaltet, dass die Fernabschaltung der Batterie möglich ist nach Kündigung und entsprechender Ankündigung der Sperre.
Der BGH sah in dem Fernzugriff auf die Batterie eine Besitzstörung im Sinne von § 858 BGB. Die Frage, ob dies ausscheide, weil eventuell der Vermieter Mitbesitzer geblieben sei, musste nicht entschieden werden, da die Klausel, die der BGH zu überprüfen hatte, einseitig war. Es wurde festgestellt, dass es sich um eine derart einseitige Vertragsgestaltung handelt, die hier missbräuchlich die eigenen Interessen auf Kosten des Mieters durchzusetzen versucht, ohne die Interessen der anderen Seite angemessen zu berücksichtigen. Durch die Fernabschaltung wird einseitig dem Mieter auferlegt, im Streitfall nur durch gerichtliche Geltendmachung die weitere Gebrauchsüberlassung zu erzwingen. Die zwar grundsätzlich berechtigte Möglichkeit des Mieters, künftig die weitere Nutzung des Mietobjekts nach Kündigung zu unterbinden ist zwar vorhanden, bei Streitigkeiten, z. B. über Mietminderung oder Zurückbehaltungsrecht wegen Mängeln, läuft der Mieter jedoch Gefahr, einer Abschaltung zu unterliegen. Die gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen wird daher ausschließlich einseitig auf den Mieter verlagert.
Die Interessen des Vermieters sieht der BGH durch Vereinbarung einer Mietkaution als ausreichend möglich. Zudem bestünde bei weiterer Nutzung ein Anspruch auf Nutzungsentschädigung nach § 546a BGB. Dies müsse ausreichen, da es nicht äquivalent sei, eine vollständige Nutzloswerdung des Fahrzeugs bei Batteriesperrung hierfür zu ermöglichen. Durch die Batteriesperrung wird ein wesentlich höherer Vermögensbestandteil für den Mieter unbrauchbar und zwar das zugehörige E-Auto.
Folge ist hiermit ein Verstoß gegen § 307 Abs. 1, 2 BGB.
Dies entschied der BGH mit Urteil vom 26.10.2022, XII ZR 89/21.